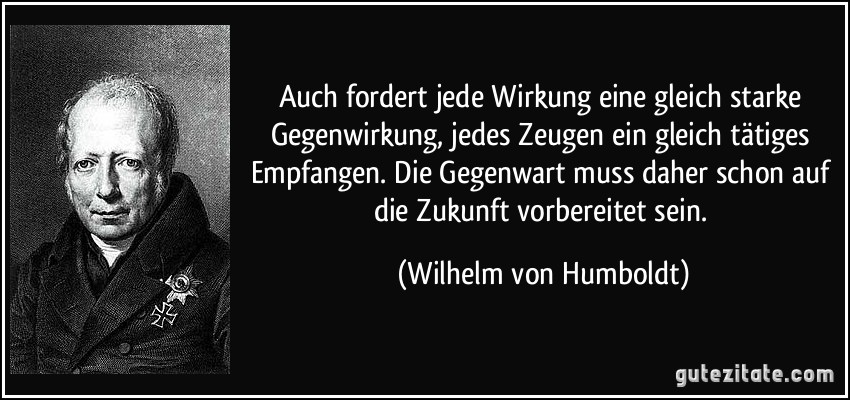(Bild: Quelle)
“Und sie werden unter diesem Schuldspruch verbleiben, bis sie umkehren und sich an den neuen Bund erinnern, nämlich das Buch Mormon und die bisherigen Gebote, die ich ihnen gegeben habe, und nicht nur reden, sondern gemäß dem, was ich geschrieben habe, handeln” (Lehre und Bündnisse 84:57).
Lehre und Bündnisse 84:54-91 – Historischer Kontext, geistliche Lehren und biblische Parallelen
1. Verse 54‑57 – „Verdunkelte Gemüter“ und die neue Bundesurkunde
Ende September 1832 hatten viele Missionare ihre ersten Einsätze hinter sich; die Euphorie der jungen Kirche war spürbar. Doch der Herr durchschneidet jede Selbstzufriedenheit: „Eure Gemüter sind in der Vergangenheit verfinstert worden … weil ihr den neuen Bund leicht geachtet habt.“ Gemeint ist ausdrücklich das Buch Mormon. Schon Moroni bezeichnete diese Schrift als Siegel der Letzten Tage (Ether 5:1‑4); hier wird sie zur Bundesurkunde zwischen Gott und Zion. Das biblische Echo klingt in Hosea 4:6: „Mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis.“
Historisch reagierte William W. Phelps sofort: In der Evening and Morning Star (Jan. 1833) widmete er dem Buch Mormon mehrere Leitartikel und fragte selbstkritisch, ob die Heiligen „mysteriöse Prophezeiungen jagen“ statt das gegebene Licht zu nutzen. Spätere Propheten haben die Verdammnis‑Diagnose nie aufgehoben. Präsident Ezra Taft Benson mahnte 1986, die Kirche bleibe unter Verdammnis, solange das Buch Mormon nicht Herzstück von Studium, Familie und Mission sei. Damit ist Vers 57 – „nicht nur sagen, sondern tun“ – eine dauerhafte Handlungsanweisung.
2. Verse 58‑61 – Früchte bringen statt Theorie hüten
Der Herr will, dass die neuen Bundes‑Leser „Frucht bringen, die für das Reich des Vaters taugt“ (V. 58). Das erinnert an den Gleichnisbaum in Lukas 13:6‑9: Wer lange unfruchtbar bleibt, riskiert, umgehauen zu werden. Die Apostel McConkie und Holland haben daraus die Forderung abgeleitet, Buch‑Mormon‑Kenntnis in gelebte Barmherzigkeit umzusetzen – persönliches Beten, Handeln, Zeugnisgeben.
3. Verse 62‑65 – „Geht in die ganze Welt“: das universale Apostelmandat
Ohne Quorum der Zwölf (das erst 1835 berufen wurde) nennt der Herr die zurückgekehrten Ältesten dennoch „meine Apostel“ (V. 63) – im ursprünglichen Sinne „Gesandte“ (griech. apostolos). Auf sie wird das Mark 16‑Versprechen übertragen: „Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben“ (vgl. Mk 16:17‑18). Wörtlich übernimmt die Offenbarung das Schutz‑Motiv: Schlangenbiss und Gift sollen den Dienern nichts anhaben (V. 72). Für Joseph Smith war das eine persönliche Zusage: Wenige Monate zuvor hatte er in Greenville, Indiana, Gift erbrochen und wurde erst durch eine Segnung gerettet.
Schon 1832 bestätigte die Praxis das Versprechen. William E. McLellin notierte, wie Brandwunden eines Kleinkinds mithilfe einer Priestertums‑Segnung gar nicht erst Blasen schlugen. Gleichwohl folgt die mahnende Einschränkung: „Ihr sollt dieser Zeichen nicht prahlen“ (V. 73). Das steht in Linie mit Jesu Warnung, Almosen „nicht vor den Leuten auszuposaunen“ (Mt 6:2).
4. Verse 66‑76 – Missionsprinzipien: senden, statt selbst stets zu gehen
„Wohin ihr nicht gehen könnt, dorthin sendet“ (V. 62). Ein Jahr später wurde daraus das Allgemeine Missionsspendenkonto entwickelt – eine frühe Form des heutigen weltweiten Unterstützungsfonds. Außerdem verspricht der Herr, dass Heilungen und Dämonenaustreibungen als Bestätigungszeichen dienen (V. 67‑70). Allerdings: „Wer nicht glaubt … wird verdammt“ (V. 74) – ein Echo auf Johannes 3:18. Die Offenbarung betont damit den entscheidungshaften Charakter des Evangeliums: Barmherzigkeit und Gericht liegen eng beieinander.
5. Verse 77‑82 – „Ich nenne euch Freunde“ und das Leben ohne Sorge
Vers 77 verschiebt die Beziehungsebene: Wer gesandt wird, ist nicht nur Diener, sondern Freund des Herrn – ein Motiv aus Johannes 15:15. Daraus folgt der Anspruch auf göttliche Versorgung: „Nehmt keinen Beutel mit … der Arbeiter ist seines Lohnes wert“ (V. 79; vgl. Lk 10:4‑7). Die frühen Missionare gingen „ohne Börse oder Tasche“; seit Mitte des 20. Jh. bringen Familien die Mittel selbst auf, doch bleibt die Kernidee: Vertrauen vor finanzieller Absicherung.
Der Herr ergänzt: Wer so dient, soll „nicht müde werden an Leib, Glied oder Gelenk“ (V. 80). Präsident Neal A. Maxwell deutete diesen Satz als geistige Erfrischung trotz Jetlag – wahrnehmbar für heutige reisende Autoritäten.
6. Verse 83‑85 – Spontane Inspiration statt fertigem Drehbuch
Wie schon in Matthäus 10:19 verheißt der Herr, die Botschaft werde „in jener Stunde“ eingegeben (V. 85). Elder Dilworth Young nannte dies das „größte Geschenk“ eines Missionars: vorbereitet sein, aber nicht vorformuliert, offen für das Flüstern des Geistes.
7. Verse 86‑91 – Engelschutz und himmlische Logistik
Die Schlussverse weben eine Schutzgarantie: „Ich werde vor eurem Angesicht hergehen … Engel werden euch tragen“ (V. 88). Wilford Woodruff bezeugte 1840 in London eine nächtliche Befreiung durch drei himmlische Wesen in Tempelkleidung – klassisches Beispiel für Vers 88. Gleichermaßen verspricht der Herr, wohltätige Gastgeber würden „Lohn“ empfangen (V. 90) – eine Neuformulierung von Matthäus 10:41‑42 („… wer einen Propheten aufnimmt, empfängt Lohn eines Propheten“).
Die logistische Zusicherung „derselbe wird euch speisen, kleiden, Geld geben“ (V. 89) deckt sich mit heutigen Erfahrungen: Ob Spendenkasse, mitfühlende Mitglieder oder unverhoffte Weggefährten – Mission ist in erster Linie Glaubensökonomie.
8. Gegenwartsrelevanz
- Schriftzentrierung – Die anhaltende Verdammnis mahnt jede Generation, das Buch Mormon nicht nur zu besitzen, sondern zu verkörpern. Familienabende, TikTok‑Clips oder Institutsklassen sind erst sinnvoll, wenn sie Herz und Hand bewegen (Jak 1:22).
- Demut bei geistigen Gaben – Wunder sollen erbauen, nicht beeindrucken. In einer Selfie‑Kultur gilt Vers 73 als Gegenprogramm: keine Wundermarketing‑Shows.
- Missionarischer Sinn für Weite – Wer nicht selbst reisen kann, sendet (Vers 62). Das schließt Online‑Unterstützung, FamilySearch‑Arbeit oder simple Spenden ein, sodass Elder Packer’s „kleiner Junge von Cuzco“ irgendwann erreicht wird.
- Vertrauen statt Angst – Die Zusage von Engelschutz (Vers 88) ist kein Freibrief für Leichtsinn, aber ein Gegengewicht zu heutigen Sicherheits‑ und Versorgungssorgen.
Schlussbild
Vers 90 stellt die Missionsgleichung auf: Wer die Diener unterstützt, berührt den Himmel. Die ganze Passage 54‑91 spannt so einen Bogen: Von der persönlichen Umkehr zum Bundesbuch über die machtvolle Sendung, die Welt zu heilen, bis zur Zusage, dass himmlische Hände untergreifen, wo irdische Hände zu kurz reichen. Der Herr verbindet Schrift‑Treue, Missionseifer und gelebtes Vertrauen zu einer einheitlichen Agenda: „Bewahrt Licht, tragt Licht, und ich werde euer Licht sein.“ In einer Zeit digitaler Reiz‑Überflutung und globaler Verunsicherung ist das nicht weniger als ein Rettungs‑Fahrplan für Heilige der Letzten Tage – heute.